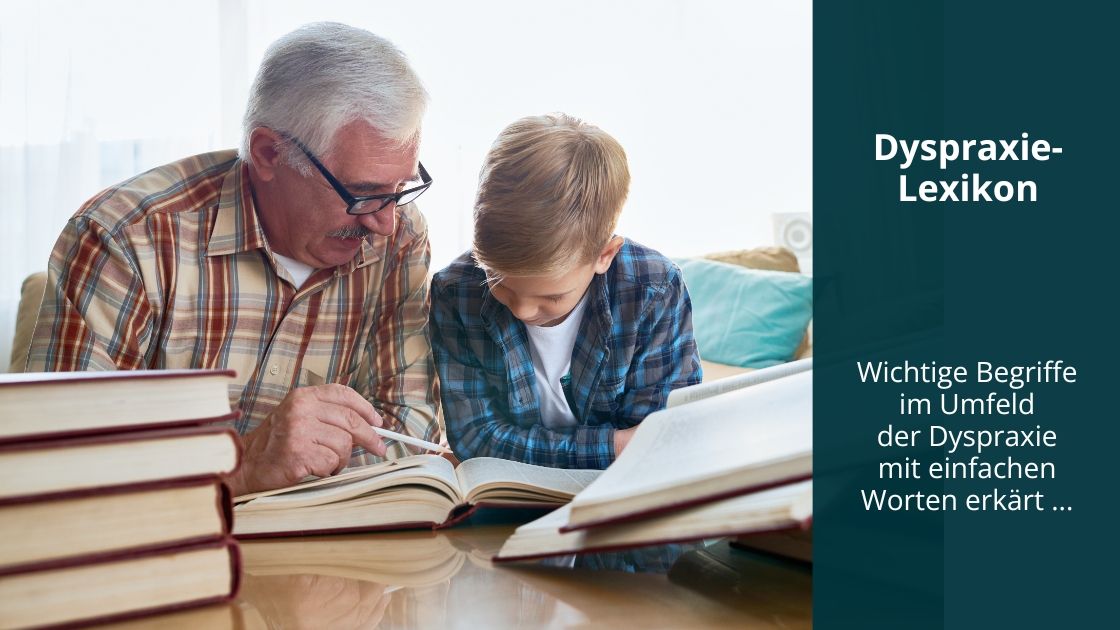A bis C
ADHS
ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und ist eine der häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen; kann aber auch im Erwachsenenalter fortbestehen. ADHS ist eine neurologische Entwicklungsstörung, bei der die Informationsübertragung im Gehirn beeinträchtigt ist. Die Ursachen sind vielfältig und nicht abschließend geklärt, aber genetische und neurobiologische Faktoren spielen eine wichtige Rolle. ADHS ist nicht heilbar, aber mit gezielter Behandlung und Unterstützung können Betroffene oft eine gute Lebensqualität und Entwicklung erreichen. Viele Menschen mit ADHS haben auch besondere Stärken wie Kreativität und Flexibilität.
Apraxie
Apraxie ist eine neurologische Störung, bei der Betroffene trotz intakter motorischer und sensorischer Fähigkeiten nicht in der Lage sind, zielgerichtete oder komplexe Bewegungsabläufe auszuführen. Das bedeutet, dass die Muskulatur funktioniert und keine Lähmung oder Koordinationsstörung vorliegt, aber die Fähigkeit, Bewegungen bewusst zu planen und auszuführen, ist gestört. Typische Beispiele sind Schwierigkeiten beim Anziehen, beim Benutzen von Werkzeugen (wie einem Hammer oder einem Korkenzieher), beim Nachahmen von Gesten oder beim Ausführen von Mimik und Sprache.
Aufgabenorientierter Ansatz
Bei diesem modernen Therapieansatz wird nicht eine allgemeine Fähigkeit trainiert, sondern eine ganz konkrete Alltagsaufgabe. Statt "Ballfangen" zu üben, wird zum Beispiel das Werfen des Basketballs in den Korb geübt, bis es automatisiert ist.
Basalganglien (Basal Ganglia)
Eine Gruppe von Nervenzellkernen tief im Gehirn, die eine wichtige Rolle bei der Planung und Automatisierung von Bewegungen spielen. Eine Dysfunktion in diesem Bereich wird ebenfalls als mögliche Ursache für DCD / Dyspraxie diskutiert.
Bayley-III
Die Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley-III) ist ein international weit verbreiteter, standardisierter Entwicklungstest zur Beurteilung der kindlichen Entwicklung im frühen Kindesalter, insbesondere bei Kindern von 1 bis 42 Monaten. Ursprünglich von der Psychologin Nancy Bayley entwickelt, wird das Verfahren eingesetzt, um Entwicklungsverzögerungen zu erkennen, den Entwicklungsstand zu dokumentieren und gezielte Interventionsmaßnahmen abzuleiten.
Bewegungssequenzierung (Motor Sequencing)
Hiermit ist die Fähigkeit gemeint, einzelne Bewegungsschritte in der richtigen Reihenfolge auszuführen. Tätigkeiten wie Zähneputzen oder das Binden von Schnürsenkeln erfordern eine präzise Sequenzierung, die bei DCD / Dyspraxie beeinträchtigt ist.
Bilaterale Koordination (Bilateral Coordination)
Dies beschreibt die Fähigkeit, beide Körperhälften koordiniert zusammen oder abwechselnd zu benutzen. Schwierigkeiten zeigen sich für Dyspraktiker zum Beispiel beim Schneiden mit der Schere (eine Hand hält, die andere schneidet) oder beim Fahrradfahren.
BOT-2
Der Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Zweite Ausgabe (BOT-2), ist ein standardisiertes, international anerkanntes Testverfahren zur Erfassung der motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen. Er dient insbesondere der differenzierten Beurteilung von Fein- und Grobmotorik und ist für die Altersspanne von etwa 4 bis 21 Jahren konzipiert, wobei die deutschsprachige Version typischerweise für das Alter von 4 bis 14 Jahren ausgerichtet ist. Der Test wird vor allem in der pädiatrischen Ergotherapie, Physiotherapie, Motopädie, Psychologie und Pädagogik eingesetzt, um motorische Schwächen zu identifizieren und Entwicklungsverläufe zu dokumentieren. Er besteht aus verschiedenen Subtests, die unter anderem feinmotorische Genauigkeit, manuelle Koordination, Körperkoordination, Gleichgewicht, Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ballfertigkeiten messen.
Cerebellum (Kleinhirn)
Ein Bereich im Gehirn, der für die Koordination, das Timing von Bewegungen und das motorische Lernen entscheidend ist. Studien deuten darauf hin, dass bei DCD / Dyspraxie die Funktion des Kleinhirns und seiner Netzwerke beeinträchtigt sein könnte.
Clumsy Child Syndrome
Dies ist ein veralteter und heute als stigmatisierend empfundener Begriff für DCD. Er beschreibt lediglich das äußere Erscheinungsbild (die "Ungeschicklichkeit"), ohne die neurologischen Ursachen zu berücksichtigen. In Deutschland sprach man lange vom "Syndrom des ungeschickten Kindes". Experten und Fachleute verwenden diesen Ausdruck heutzutage nicht mehr.